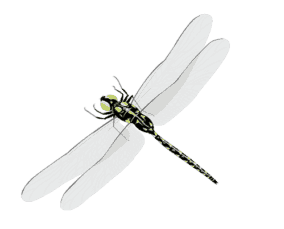können Viren, Noxen oder Zinkmangel die Ursachen solcher Riechstörungen sein
Gerüche steuern unser Verhalten und unsere Emotionen, sie werden als betörend oder unangenehm empfunden, sie helfen, wohlgeratene Speisen von verdorbenen zu unterscheiden, und warnen vor ätzenden, giftigen Substanzen. Doch was ist, wenn sich die Nase mit ihren zehn bis 20 Millionen Rezeptorzellen in der Riechschleimhaut irrt und dem Gehirn statt Wohlgeruch Gestank oder überhaupt nichts meldet?
Olfaktorische Störungen, etwa bei einem Schnupfen, sind zwar lästig, aber meist vorübergehend. Weniger harmlos – und für Menschen, die etwa als Koch, Weintester oder Chemiker arbeiten, richtig problematisch – sind hingegen dauerhaft verzerrt empfundene Düfte. Dann werden zu viele, zu wenige, falsche oder gar keine Gerüche mehr wahrgenommen.
Virale Rhinitiden sind häufigste Ursache für Riechstörungen
Bei exakter Klärung der Ursachen für Riechstörungen können diese Patienten jedoch oft erfolgreich behandelt werden, wie Dr. Hans Rudolf Briner von der Klinik Hirslanden in Zürich betont (HNO-Nachrichten 4, 2002, 20).
Als häufigste Ursache für nachlassendes Riechvermögen nennt Briner die akute virale Rhinitis. Durch die entzündliche Schwellung und die vermehrte Sekretproduktion wird die Riechspalte im Nasendach verlegt. Auch allergische Rhinitis, unspezifische hyperreaktive Rhinopathie sowie chronische Sinusitis mit Polyposis nasi können das auslösen. Mitunter werden Riechschleimhaut und Rezeptorzellen durch die Virusinfektion zusätzlich dauerhaft geschädigt.
Auch Noxen wirken schädigend, etwa Lösungsmittel oder Schwermetalle. Oft sind aber solche Schädigungen reversibel. Meist dauert die Erholung Wochen bis Monate. Weitere Ursachen sind Zinkmangel bei chronisch Nieren-, Leber- und Darmkranken, selten hingegen Riechepithel-Tumoren.
Neurale Übertragungsstörungen werden zumeist durch Schädeltraumata, manchmal durch Meningeome ausgelöst, zentrale unter anderen durch degenerative Erkrankungen wie Morbus Alzheimer.
Zur Basisdiagnostik von Störungen des Geruchssinns zählt Briner die anteriore und posteriore Rhinoskopie.
Riechstörungen lassen sich mit einem Geruchstest verifizieren. Dafür haben sich in der Praxis diese diagnostischen Verfahren bewährt:
- Screening des Geruchssinns zunächst mit traditionellen, in Apotheken erhältlichen Riechfläschen oder mit modernen Tests, die eine grössere Zahl von Geruchsstoffen beeinhalten und wissenschaftlich sowie statistisch validiert sind. Dazu gehören etwa der beim Hersteller direkt erhältliche Sniffin´Sticks® Test der Burghart Medizintechnik in Wedel, oder der Zürcher Geruchstest® vom Unternehmen Novimed in Dietikon in der Schweiz.
- Liegt eine Riechstörung vor, wird mit der computerisierten Olfaktometrie zur Bestimmung der Riechschwelle das Ausmass der Störung quantitativ und qualitativ bestimmt.
„Rhinogene Störungen, also Störungen, die durch eine Verlegung des Riechepithels bedingt sind, haben beste Aussichten auf einen Therapieerfolg“, berichtet Briner. Mit topischen Steroiden schwelle die entzündliche Nasenschleimhaut langfristig ab. Bei chronischer Sinusitis seien zeitweise zusätzlich systemische Steroide indiziert. Auch mit chirurgischer Intervention bei chronischer Sinusitis lasse sich das Riechvermögen verbessern.
Anosmie nach Influenza ist schwer in den Griff zu kriegen
Bei Zinkmangel sieht der HNO-Arzt die Substitution als erfolgversprechende kausale Therapie. Nur begrenzte medikamentöse Therapiemöglichkeiten gebe es hingegen bei epithelialen Störungen wie der häufigen Anosmie, also der Schädigung der Rezeptorzelle, nach Influenzainfekt. Nur wenige Patienten profitieren hierbei offenbar von topischen Steroiden oder Theophyllin.
Patienten mit Geruchsstörungen „über die meist benigne Natur der Erkrankung aufzuklären und Ängste vor einem Hirntumor zu nehmen“, hält Briner für besonders wichtig. Und darüber zu informieren, dass selbst „bei scheinbar aussichtslosen Fällen wie nach einer Frontobasisfraktur sogar noch nach mehreren Jahren Spontanheilungen möglich sind“.
STICHWORT
Quantitative und qualitative Riechstörungen
Folgende quantitative Riechstörungen nennt der Schweizer HNO-Facharzt Dr. Hans Rudolf Briner in Abgrenzung zur Normosmie:
- Bei Hyperosmie nehmen die Patienten Gerüche übersteigert und
- bei Hyposmie vermindert wahr.
- Die Anosmie ist definiert als vollständiger Ausfall des Geruchssinns.
Ausserdem unterscheidet Briner diese qualitativen Störungen des Geruchssinns, die Dysosmien, voneinander: - die Kakosmie, wenn Patienten Gerüche falsch als faul oder unangenehm empfinden,
- die Heterosmie, wenn sie unfähig sind, Gerüche zu differenzieren,
- die Agnosmie, wenn wahrgenommene Gerüche nicht erkannt werden oder,
- die Phantosmie, auf einer Sinnestäuschung beruhen. (hsr) [Von Helmut Schneider]